Und plötzlich ist das Leben ein großes Geschenk
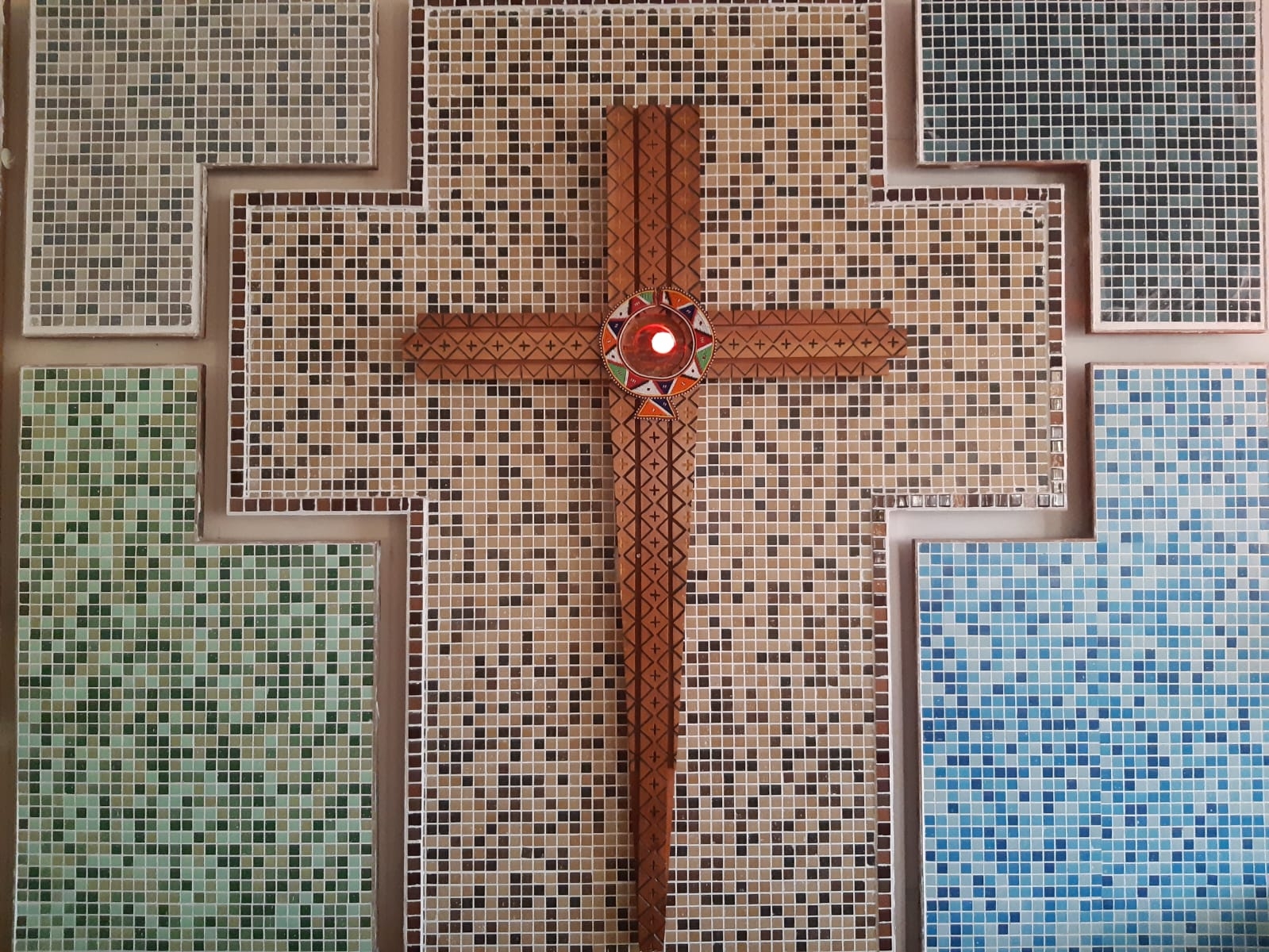
Gestern morgen mussten Sr. Gabriele Maria und ich von Kerstin, Klaus und den Schwestern Abschied nehmen, um nach Nairobi zu fliegen. Schon die Fahrt zum Flughafen war von unterschiedlichen Eindrücken geprägt. So viele Straßenkinder wie noch nie und noch mehr Militärpräsenz in den Straßen und sogar auf den Dächern. Alle schwer bewaffnet.
Dann startete unser Flugzeug nicht zur geplanten Zeit und plötzlich verließen einige Passagiere fast fluchtartig das Flugzeug. Eine wirkliche Information gab es nicht und die Crew wirkte auch fast versteinert. Nach einer Stunde schaltete jemand endlich die Klimaanlage an, dann wurde mal ein Glas Wasser gereicht. Auffällig war nur, dass die Einheimischen immer nervöser wurden und immer häufiger das Flugzeug verließen.
Irgendwann antwortete dann eine Stewardess auf meine Frage und wir erfuhren, dass die Maschine, die vor uns nach Kenia flog, abgestürzt ist. Meine Güte. All die Menschen. Tot. Deshalb war auch die Crew so geschockt. Hatten sie doch gerade erfahren, dass ihre Kolleg*en gestorben sind. So viele Menschen, die um ihre Liebsten trauern. Und dann waren unsere Gedanken natürlich bei denen, die sich nun um uns Sorgen machten und die wir nicht erreichen konnten.
In meiner Tasche waren noch zwei Stückchen edler Schweizer Schokolade, die haben wir noch bewusst und mit Genuss verzehrt, bevor dann endlich das Flugzeug mit zwei Stunden Verspätung Addis verließ. In Nairobi hatten wir dann zu allem Überfluss auch noch Probleme mit dem Visum. Doch irgendwann konnten wir das Gebäude verlassen und wurden abgeholt. Nun können wir uns im Gästehaus der CMI-Father erst mal von den Aufregungen erholen und sind gespannt, was der neue Tag so bringen mag. Auf alle Fälle aber ist jeder Tag zuerst einmal ein Geschenk.
Abschied

Und nun hiess es schon wieder Abschied nehmen. In aller Frühe haben wir uns auf den Weg nach Addis gemacht. Und das war auch gut so, denn zu dieser Jahreszeit wird es schon auch richtig heiß und die Straßenverhältnisse sind nach wie vor ziemlich katastrophal. Aber wir sind gut angekommen, voller Eindrücke und nach der obligatorischen Kaffeezeremonie zum Willkommen war sogar noch ein Spaziergang durch das Viertel drin.
Überall wurden wir aufmerksam beäugt, Kinder rannten hinter uns her. Und vorübergehend wurde es zur Mutprobe, die Englischkenntnisse auszuprobieren und uns anzusprechen. Die wahren Helden des Tages wagten es, uns die Hand zu geben. So sammelten wir überall viel Lachen ein.
Frauenpower am Ende der Welt

Shaki ist eine der Außenstationen der Pfarrei in Komto. Sr. Helen, die im letzten Sommer erst ihre Gelübde abgelegt hat, ist dort für eines der Mikrofinanzkreditprojekte für Frauen zuständig. Sr. Martha als Sozialarbeiterin und Koordinatorin der Diözese hat uns begleitet und die Arbeitsweise der Frauengruppen erklärt. Wieder einmal waren wir tief beeindruckt. Einmal von den Regeln zu den Entscheidungsprozessen, dem Miteinander und den Kontrollwegen, die sich die Gruppe selbst gegeben hat, aber auch vom Erfolg. Alle Frauen berichteten uns, von den Erfolgen ihrer kleinen Geschäfte. Einige haben vom Kredit Kaffeesträucher angebaut und können nun sogar vom Verkauf der Kaffeebohnen ihre Kinder zur Schule schicken. Irgendwie ist aber auch zu spüren, dass diese Projekte das Selbstbewusstsein der Frauen ungeheuer gestärkt haben.
Zwei- bis dreimal in der Woche treffen sich die Gruppen und erhalten verschiedene Fortbildungen. Unter anderem lernen die Frauen zu Beginn des Projektes ihren Namen zu schreiben, um dann auch für die Kredite und die Rückzahlung der Zinsen unterschreiben zu können. Aber auch Themen wie Sparen, Familienplanung und Schutz vor häuslicher Gewalt werden diskutiert.
Heute hatte sich auch ein älterer Mann unter die Frauengruppen gemischt. Seine Frau war Teil der Gruppe und starb vor wenigen Tagen. Für ihre ärztliche Versorgung im Krankenhaus musste er die Schafe vom Projekt seiner Frau verkaufen. Nun blieb er ohne Frau und ohne Schafe zurück, traurig und verzweifelt. Doch die Regeln des Projekt erlauben ihm keinen Einstieg zum momentanen Zeitpunkt. Er muss warten, bis einige Frauen und Männer zusammen kommen und eine neue Gruppe starten können. Ob er so lange warten kann, haben Besucher und Schwestern schwer bezweifelt und kurzerhand die 1000 Birr (ungefähr 30 Euro) zusammen gelegt.
Hoffnungszeichen?

Nachdem beim letzten Besuch, die lange leer gestandene und nie richtig genutzte Werkstatt in Ariajavi geputzt und notdürftig auf Vordermann gebracht wurde, konnten wir nun tatsächlich konzentrierte Arbeit erleben. In zwei Gruppen erhalten junge Leute nun eine sechsmonatige Ausbildung – mehr Nähmaschinen gibt es leider nicht! Bis jetzt noch nicht! Hoffentlich!
Denn wenn wir durch Nekemte fahren, sind wir einfach immer wieder entsetzt über die vielen jungen Leute, die arbeitslos am Straßenrand stehen. An manchen Ecken in der Stadt warten die sogenannten Tagelöhner auf Arbeit. Viele von ihnen warten den ganzen Tag und gehen am Abend ohne Verdienst nach Hause – wenn sie ein Zuhause haben…
Seit meinem letzten Besuch scheint die Stadt noch voller. Zu Besuch beim Bischof erfahren wir, dass auf Grund der aktuellen, blutigen, ethnischen Konflikte in der Region 200.000 Menschen aus ihrem angestammten Gebiet vertrieben und nach Nekemte geflohen sind. Viele konnten bei Verwandten und Freunden Unterschlupf finden. Zusätzlich musste das UNHCR zwei Camps einrichten. Überall auf den Straßen sind die politischen Umbrüche zu spüren – auch wenn die Menschen, mit denen wir ins Gespräch kommen, der neuen Regierung vertrauen und voller Hoffnung in die Zukunft schauen, sind die Herausforderungen riesig.
Das Leben brummt

So schön, wir kommen zu den Schwesternstationen und das Leben brummt. Seit einem halben Jahr sind die Schwestern in Ambo und die Arbeit im Kindergarten scheint gut weiter zu laufen. Zumindest machen die Kinder einen zufriedenen Eindruck und tollen wild über das Gelände. Auch die Schwestern haben sich gut eingelebt. Nun kommen schon weitere Anfragen. Eine Grundschule sollte gebaut werden. Doch zuerst stehen einige Sanierungen im Kindergarten an.
Eine andere Anfrage hat unser vinzentinisches Herz höher schlagen lassen. Ganz in der Nähe des Schwesternhauses betreiben die Vinzentiner eine Schule für Kinder mit Hörschädigungen. Seit einigen Jahren haben hier Kinder mit Hörschädigung erstmal die Möglichkeit zur Schulbildung. In den Klassen erkennt man, dass einige der Kinder und Jugendlichen wohl spät eingeschult und in ihren ersten Lebensjahren stark vernachlässigt und vor der Umgebung versteckt wurden.
Jetzt soll ein Internat gebaut werden, damit auch Kinder aus den Dörfern die Möglichkeit haben, zur Schule zu gehen. Das heißt, eine der Schwestern kann schon bald damit beginnen, die Gebärdensprache zu lernen, damit sie dann dort die Schüler betreuen kann. Das Netzwerk wird also ausgebaut. St. Josef, Schwäbisch Gmünd in Deutschland, St. Vincent, Ruhuwiko in Tansania und in Zukunft vielleicht auch Ambo in Äthiopien mit Freiwilligen aus einer Schule für Hörgeschädigte von Vinzentinern in Irland… die weltweite vinzentinische Familie wächst.
Unterwegs ins “Dorf der Hoffnung” (Gastautorin: B. Grosch)

7:30 Uhr: Wir starten nach Mtwango Ilunda, “Dorf der Hoffnung”, Kinderdorf für Aidswaisen. Vorbei an kleinen Dörfern, kleine Kirchen und kleine Moscheen, einige Kinder rennen an den Straßenrand und winken uns zu.
Der Tourismus hier ist noch sehr überschaubar. Viele Kinder können nicht in die Schule, der Schulweg ist zu weit, die Eltern können sich oftmals den Schulbus und die Schuluniform nicht leisten.
Zwischenstopp in Isimila, Steinzeit, alter Steine aus Sandsteinsäulen, wo vor 300.000 Jahre Menschen gelebt haben.
Ankunft im Kinderdorf.
Die Schwestern und die Kinder begrüßen uns mit einem Willkommenslied. Die Kinder wollen unbedingt unsere Koffer in das Gästehaus rollen. Wir machen uns Sorgen und haben Angst, teilweise sind die Koffer größer als die Kinder. Wir beziehen unsere Zimmer, Doppelzimmer und Drei-Bett-Zimmer. Anschließend gibt es eine Führung durch das Kinderdorf von der Oberin. Es leben 78 Kinder hier, die kleinsten zwei und vier Monate alt. Zum Abschluss des Tages ein gemeinsames Abendessen zusammen mit den Schwestern.

Isimili Stone Age
Interessantes, Belustigendes und Bedrückendes: ein Tag in Mbinga (Gastautor: Dr. Thomas Broch)

Heute beginnt die Auszählung zur Wahl der neuen Regionaloberin. Nach der Eucharistiefeier und dem Frühstück lassen sich Sr. Anna-Luisa und Sr. Damiana dazu im großen Versammlungssaal nieder. Zwei Tage hatten sie dafür vorgesehen, gegen 11 Uhr sind sie allerdings bereits fertig, zumindest für den ersten Wahlgang – zur großen Überraschung von Harald Geissler und Thomas Broch, die sich derweil mit Sr. Kaja auf den Weg zur Besichtigung der weitläufigen Klosteranlage gemacht haben.
1969 ist das Haus St. Maria als erstes Gebäude der Vinzentinerinnen in Mbinga errichtet worden – mit folgender Vorgeschichte: Die Kandidatinnen in Untermarchtal hatten im Jahr 1958 im Rahmen einer Sternsingeraktion Geld für den aus Ertingen bei Riedlingen stammenden Abtbischof Eberhard Spieß OSB in der tansanischen Benediktiner-Abtei Peramiho gesammelt. Dieser war darüber zwar hoch erfreut, meinte jedoch, die Entsendung von Schwestern wäre ihm noch willkommener. So machten sich 1960 zunächst einmal vier Schwestern – eine davon mit Umweg über London – aus dem Schwäbischen auf den Weg und wurden in Maguu in einer Pfarrei eingesetzt. Fünf Jahre später, 1967, folgten vier weitere Schwestern. Der Gemeindepfarrer von Mbinga, ebenfalls ein Benediktiner, befand jedoch, für die Arbeit der Schwestern sei in der Provinzstadt mit all ihrer Not mehr Bedarf als in einem abgelegenen Nest. So siedelten die Schwestern um und übernahmen in Mbinga von der Pfarrei die Domestic-School, die Haushaltsschule. Weitere Schwestern kamen nach. Heute zählt die Gemeinschaft in Tansania über 230 fast ausschließlich einheimischen Schwestern, etwa 80 von ihnen leben zusammen mit 17 Novizinnen in Mbinga selbst; die anderen sind in 26 Stationen über vier Diözesen hinweg eingesetzt. In Äthiopien ist von Mbinga aus eine neue Region am Entstehen. Es ist eine große Gemeinschaft geworden.
Die Domestic-School und das dazu gehörige Internat gibt es immer noch. Derzeit leben und lernen dort 58 Mädchen und junge Frauen, regulär sind es zwischen 70 und 90. Sie haben die Secondary- und oft sogar die Primary-School nicht geschafft und stammen aus den ärmsten Familien, die meisten von ihnen können das Schulgeld nicht aufbringen. Bis zu 500 km reicht der Radius des Einzugsgebiets, aus dem sie nach Mbinga kommen; oft sind es Schwestern aus Mbinga, die auf die Not der Mädchen aufmerksam werden und sie hierher empfehlen. Wenn sie dann mit einem Abschluss als Näherinnen oder Köchinnen die Schule wieder verlassen, haben sie zumindest eine reale Chance auf bessere Lebensverhältnisse. Rund ein Drittel der Schwestern, die heute zu der Gemeinschaft gehören, waren selbst einmal Schülerinnen hier. „Man muss aufpassen“; lacht Sr. Kaja, „ich kann nie wissen, ob meine Schülerin nicht später einmal meine Oberin wird.“
Als wir durch die Schule gehen, ist erst ein Teil der Schülerinnen aus dem Urlaub zurück, mit ihren Gedanken sind sie wohl noch eher zu Hause als wieder hier im Schulalltag – auch mit all den Sorgen, die sie aus ihren Familien mit hierher genommen haben. In einer Klasse unterrichtet ein junger Lehrer gerade Mathematik, in einer anderen eine junge Lehrerin Englisch. In einem Raum voller Nähmaschinen sitzen zwei junge Männer und nähen; sie unterrichten sonst die Schülerinnen in dieser Fertigkeit, heute allerdings ist nur ein Mädchen da. Die Jugendlichen wirken ein wenig schüchtern; aber das sei nicht immer so, meint Sr. Kaja. Draußen im Hof kocht Angela – früher selbst Schülerin, jetzt als Köchin tätig – gerade am offenen Feuer in großen Kesseln eine Gemüsesuppe, kurz darauf werden die Schuluniformen ausgeteilt; nicht ohne Stolz präsentiert Sr. Kaja auch die farbenprächtigen kunstgewerblichen Arbeiten, die die Schülerinnen angefertigt haben und die ein wenig zum Einkommen beitragen. Aus dem benachbarten Gemeindehaus der Pfarrei dringen lautstark Gesang und auch Geschrei einer charismatischen Gruppe, die sich dort trifft. Man duldet das, damit die Menschen, die sich durch diese Form von Spiritualität angezogen fühlen, nicht eine der zahlenreichen Pentecostal-Kirchen abwandern, die auch in Afrika enorme Verbreitung und Zulauf finden.
Der Rundgang führt weiter: auf dem Hof vor den Werkstätten reparieren drei junge Männer gerade einen Traktor. In der Schreinerei werden Kinderbetten angefertigt; in der Schlosserei geben Kunstschmiedearbeiten – Grabkreuze, ein Osterleuchter, kleine mit Kohle beheizte Kocher – Zeugnis von den Fertigkeiten von Sr. M. Agnes. Im Hof des Konventsgebäudes sind Arbeiter dabei, riesige Mengen Brennholz zu verarbeiten.
Und dann eröffnet sich hinter Konventsgebäude und Kirche das weite Feld der Landwirtschaft: die Schweineställe, der Kuhstall, die Hühnerställe; in einem Zwinger sieben Hundewelpen. An einer Stelle trocknen ein Mann und eine Frau Kaffeebohnen. Es wachsen Bananenstauden, die Mangobäume blühen gerade, es gibt Papaya-Bäume und japanische Kirschen; Süßkartoffeln, Rosmarin, Kräuter und Gewürze vielfältigster Art – und das alles vor der wunderbaren Kulisse der Bergkette am Horizont.
Für das Nachmittagsprogramm sind zunächst zwei eigentlich nur kurze Ereignisse in der Stadt vorgesehen – so erscheint es uns wenigstens, obwohl wir gewarnt worden sind –: Geld wechseln bei einer Bank in der Stadt und Einkauf von SIM-Karten für die Mobiltelefone. Zur ersten Maßnahme: Ganz in der Nähe – nach einem kurzen Gang über den lokalen Markt voller farbenprächtiger Bilder und Eindrücke – finden wir eine Bank, die National Microfinance Bank PLC. Durch die Vermittlung von Sr. Mwombezi Mwenda, die wir zufällig vor dem Gebäude treffen, werden wir an den wartenden einheimischen Kunden vorbei ins Office geschleust. Dort erwartet uns, d. h. Harald Geißler und Thomas Broch, eine längere Prozedur. Wir dürfen Platz nehmen, bedächtig wird unser Anliegen erwogen, die vorgesehene Geldmenge reflektiert (und das auch noch in US-Dollar und Euro); die Pässe werden geprüft und gescannt, Formulare werden ausgefüllt – zuerst ein falsches, dann ein korrektes. Dann erfolgt sehr lange nichts. Ernst aussehende Herren gehen immer wieder in einen nur mit Code zugänglichen Raum, kommen wieder, verschwinden wieder darin. Der junge Angestellte, der uns schon zu Beginn bedient hat, flüstert uns mit gewichtiger Miene zu, wir sollten uns doch bitte gedulden. Das tun wir. Inzwischen sind Sr. Anna-Luisa und Sr. Damiana dazu gestoßen, eher etwas ungeduldig, aber auch dies beschleunigt das Verfahren nicht. Ein Herr, mutmaßlich in höherer Position, setzt sich zu uns, stellt sich vor, fragt uns nach dem Woher und Wohin und ob wir das Geld ins Ausland transferieren wollen, was wir verneinen. Auch er geht wieder. Sr. Mwombezi taucht auf, redet mit einem der Angestellten, wohl um den Fortgang der Dinge zu befördern … Drei Herren tauchen schließlich auf, setzen sich an ihre Schreibtische und schauen uns an, ein wenig plaudern wir mit einander. Schließlich, mehr als eine Stunde mag vergangen sein, kommt ein weiterer Herr mit einer dick mit Geldscheinen gefüllten Papiertüte. Der junge Mann vom Anfang erläutert uns das Zustandekommen der jetzt auszuhändigenden Geldsumme, erbittet unsere Unterschrift – das erste Vorhaben ist gelungen. Wir verlassen die Bank, ignorieren die Warnung, uns mit dem Geld weiter durch die Stadt zu bewegen, da wir sicher beobachtet worden seien, und suchen den Ort des nächsten Ereignisses auf: einen Verkaufsstand am Straßenrand, wo ein paar junge Männer SIM-Karten von Vodacom verkaufen.
Dort folgt der zweite Akt: SIM-Karten und Vochas zum Freirubbeln wären eigentlich schnell erstanden. Aber das Problem mit dem Freischalten … Nach vielen Versuchen der jungen Leute, die Passnummer ihrer Kunden über das Smartphone an den Anbieter zu übermitteln, scheitern schließlich daran, dass das mit deutschen Pässen nicht möglich ist. Aber Sr. Mwombezi weiß Rat: Sie führt je einen Personalausweis mit ihrem Ordensnamen Mwombezi und mit ihrem bürgerlichen Vornamen Joyce mit sich und stellt diese für die Registrierung der SIM-Karten zur Verfügung. So kommt Harald Geißler schließlich mit dem Alias Mwombezi an seine Legitimierung, Thomas Broch dagegen als Joyce. Auch Fotos der Schwester werden aufgenommen und den Daten beigefügt. Wenn das keine Persönlichkeitsveränderung ist. Es dauert dann noch geraume Zeit, bis alle technischen Erfordernisse funktionieren …
Vonnöten ist anschließend eine kurze Einkehr in einem hübschen Café – wo man uns mit Bedauern mitteilt, es gebe leider keinen Strom und damit sei auch die Kaffeemaschine außer Betrieb. Diese missliche Situation ändert sich allerdings bald wieder, so dass bei Kaffee und Cappuccino die Welt wieder anders aussieht.
Etwas abseits der Straße, die zum Kloster zurückführt, liegt St. Katharina, ein Waisenhaus der Schwestern. Ursprünglich war das kleine Gebäude rund um einen Innenhof für nur wenige Kinder vorgesehen, jetzt leben ungefähr 20 Kinder darin, die allermeisten im Kleinkindalter, darunter zwei Neugeborene. Ihre Eltern sind an Aids oder an anderen Krankheiten gestorben oder haben die Kinder einfach verlassen. Die Platznot ist enorm, die drei Ordensschwestern und die wenigen einheimischen Helferinnen völlig überlastet. Freiwillige aus Deutschland sind erst in einiger Zeit zu erwarten. Tagsüber sind die Kinder im Kindergarten der Schwestern, für den sie eigentlich viel zu klein sind. Außerdem kommen dort so viele Kinder hin, dass den Kleinen aus dem Waisenhaus gerade das nicht gegeben werden kann, was sie am Nötigsten bräuchten: individuelle Nähe, Zuwendung und Förderung. Die Kinder, die bei unserem Besuch bereits wieder zurück in St. Katharina sind, sind allesamt stark verschnupft, aber sie reagieren ausgelassen auf die unerwarteten Besucher, wollen herumtollen, suchen Zuwendung, wollen einfach auf oder in den Arm genommen werden. „Mir tut das Herz weh“, sagt Sr. Anna-Luisa. Wir brechen bald auf, weil es die Situation nicht leichter macht, wenn die Kinder vor dem Zubettgehen noch einmal auf- und überdrehen.
Es ist wie heim kommen (Gastautor: Dr. Thomas Broch)

Ein neuer Tag, ein neuer Reisetag. Um 9.30 Uhr verlassen wir die Kommunität der Benediktiner von Kurasini wieder und kämpfen uns durch den Verkehr Richtung Flughafen Dar es Salaam – diesmal nicht zum internationalen Bereich, sondern zu dem kleineren und von Alterspatina gezeichneten nationalen Sektor, wo wir uns für den Flug TC116 der Air Tansania nach Songea einchecken – nicht ohne Hindernisse: der Officer am Schalter ist nicht gewillt, das Übergewicht unseres gesamten Gepäcks durchgehen zu lassen, aber nach längerer Diskussion und der Entrichtung einer Zusatzzahlung können wir auch hier passieren. Warten am Gate, pünktlich um 12 Uhr gehen wir zu Fuß über das Flughafengelände zu unserem Flugzeug, einer Turbo-Prop-Maschine – kleiner, gemütlicher, aber voll von Menschen, die entweder wie wir nach Songea fliegen wollen, oder – deutlich weniger – weiter nach Mtwara am südlichen Ende der tansanischen Küste vor der Grenze zu Moςambique. Dort wollen wir auch noch hin, aber erst am Ende der Reise.
Pünktliche Ankunft in Songea. Der Flughafen entbehrt nicht einer gewissen nostalgischen Romantik: der Boden des Rollfeldes war vielleicht einmal asphaltiert, jetzt besteht er nur noch aus gestampfter Erde, über die wir zu Fuß zum Ausgang gehen; später folgt in einem riesigen Handwagen, gezogen von zwei Bediensteten, das Gepäck. Am Maschendrahtzaun warten schon die Schwestern von Ruhuwiko auf uns, und nach kurzer Kontrolle in der Abfertigungshalle, einer Baracke ähnlich wie in dem Film Casablanca, begrüßen wir uns gegenseitig aufs herzlichste. (Nicht zu vergessen: In einer Halle auf dem Flughafengelände stehen drei (!) Feuerwehr-Löschfahrzeuge; man kann ja nie wissen …)
Mit zwei Fahrzeugen geht’s nach Ruhuwiko. Dort herzlicher Empfang und Mittagessen. Da wir in ein paar Tagen wieder dorthin zurück kommen werden, genügt hier die kurze Erwähnung.
Anschließend kommt das Gepäck aufs Dach des Landrovers und unsere fünfköpfige Reisegruppe nebst Fahrer ins Innere – Richtung Mbinga. Auf der verhältnismäßig gut ausgebauten Straße (von der US-Regierung finanziert, wie Werbeschilder deutlich machen), einer Dammac-Road, wie man im Afrika sagt (abgeleitet vom Erfinder asphalierter Straßen namens McAdams) führt die Route durch die weite Savannen-Landschaft, staubig von der roten Erde, immer wieder vorbei an kleinen Häusern und Häusergruppen aus roten getrockneten Ziegeln, von denen immer wieder Depots neben der Straße stehen; bei den meisten Anwesen, so hat man den Eindruck, ist mindestens ein Gebäude noch nicht fertig oder schon wieder verfallen. Es geht vorbei an kleinen Bars mit Coca-Cola-Werbung, vor denen junge und ältere Männer sitzen; vorbei an Frauen, die Wäsche waschen oder aufhängen, vorbei an Kindern, die sich durchaus vergnügt mit sich selber beschäftigen können oder mit einen alten Autoreifen spielen oder einfach am Straßenrand stehen und dem Auto mit den vielen Weißen neugierig entgegen schauen und etwas schüchtern nachwinken.
Allmählich wird die Landschaft hügeliger, dann bergiger; die Straße führt steiler bergauf und wieder bergab, die Kurven werden enger. Die Ausblicke werden weit und schön. Die Farbe der Vegetation wechselt von einem staubigen Gelb und Grau in saftiges Grün. Plantagen mit Kaffee oder Bananen oder Mais säumen den Weg. In einer Kurve halten wir an einem Kreuz: Robert Reutter steht darauf. Der Freund und Förderer des Klosters in Mbinga ist hier am 30. August 2016 tödlich verunglückt, seine Frau schwer verletzt. Am Abend im Kloster wird spürbar, dass der Schock und die Trauer immer noch nachwirken.
Nach rund zwei Stunden Fahrt erreichen wir Mbinga, den „zentralen Markt- und Distriktort im kühleren Matenga-Hochland“, wie der Reiseführer erwähnt. Mbinga ist auch Bischofssitz. Und er ist vor allem Standort für das Kloster der Region Mbinga der Barmherzigen Schwestern vom hl. Vinzenz von Paul in Untermarchtal. Der Klosterbereich mit seinem gepflegten Gebäuden und farbenfroh bepflanzten Gartenanlagen wirkt wie ein eigener Kosmos. Bereits am Eingangstor werden wir von jubelnden Schwestern begrüßt, mit Trommeln und Gesang im wahrsten Sinne des Wortes. Es ist überwältigend, diesen herzlichen Empfang zu erleben, die Wiedersehensfreude mit den deutschen Schwestern und auch mit Florian Hecke, die wissbegierig-freundliche Offenheit gegenüber den neuen und noch unbekannten Gästen.
In der Kapelle des Konvents gilt im gemeinsamen Gebet Gott der Dank für die gute Ankunft der Gäste. Die Zimmer werden bezogen, Nachmittags-Kaffe- oder Tee eingenommen, später das Abendessen – und immer wieder große Freude beim Wiedersehen mit Schwestern, die später dazu stoßen.
„Hierher zu kommen, ist immer wie heimkommen“, sagt Florian Hecke. Ja. Das kann man spüren und gut verstehen.
Hier also wird in den nächsten Tagen unser Zuhause sein.
Eine lange Anreise (Gastautor: Dr. Thomas Broch)

Es war eine lange Anreise – von Untermarchtal und Pfaffenweiler über München und Dubai nach Dar es Salaam.
Gegen 19 Uhr trifft die Reisegruppe auf dem Terminal 1 des Münchener Franz-Josef-Strauß-Flughafens ein: Sr. Anna-Luisa Kotz, Sr. Damiana Thoennes, Florian Hecke und Dr. Harald Geissler aus Untermarchtal bzw. Fulgenstadt bei Bad Saulgau und Thomas Broch aus Pfaffenweiler bei Freiburg. Am Schalter der Emirate Airline stand bereits eine lange Schlange ebenfalls reisewilliger Menschen unterschiedlichster Sprache. Die Vermutung, etwas abseits einfach noch eine kleine Weile zu warten, bis sich die Lage beruhigt haben würde, sollte sich als trügerisch erweisen. Irgendwann stehen wir – also die genannte Reisegruppe in einem nicht enden wollenden Pulk von Menschen, der sich unendlich langsam nach vorne bewegt. Kurzum: Wir haben es geschafft, der Sicherheits-Check ist überwunden, die erneut lange Schlange am Boarding-Gate ebenfalls durchgestanden, im wahrsten Sinne des Wortes … Fast eine Stunde verspätet startet die riesige Boeing 777-300ER vom Flug EK 0052, gefüllt mit rund 800 Menschen, Richtung Dubai.
Die Nacht ist entsprechend kurz, Abendessen gibt’s um Mitternacht; der Landeanflug auf Dubai erfolgt gegen 7.00 Uhr Ortszeit, also nach heimischer Zeitrechnung bereits wieder um 5.00 Uhr. Lange Wege durch den Konsumtempel mit Fluganschluss Dubai; eine Verschnauf- und Ruhepause bei Croissant mit Strawberry-Confiture und Kaffee bzw. Tee in einem scheinbar ruhigen Lokal in der ersten Etage – dann wird die Ruhe nicht endend durch eine Alarmanlage gestört, was außer uns aber kaum jemand zu stören scheint …
Erneut lange Schlange von Menschen, die alle auf dem Flug EK 0725 nach Dar es Salaam mit wollen. Irgendwie nimmt der Flieger alle auf, wartet dann aber noch unendlich lange bis zum Abflug. Gleichwohl: Dank günstiger Winde – oder wessen sonst auch immer – kommen wir ziemlich pünktlich kurz nach 15 Uhr in Dar es Salaam an. Längere Suche nach Sr. Damiana, die, wie sich herausstellt, viel früher als die anderen das Flugzeug verlassen konnte; Sicherheits-Check mit Stichprobe bei zwei Koffern von Sr. Anna-Luisa – und dann: unvorstellbares Gedränge und Chaos, lang anhaltend, am Gepäckausgabeband. Aber auch das schaffen wir. In der Halle nimmt uns Joseph, der Fahrer der Benediktiner in Kurasini, in Empfang, und mit uns NN. Aus Lauchheim bei Aaalen, die in Tansania ein vierwöchiges Klinik-Praktikum absolvieren will. Über die heiße und staubige Verbindungsstraße zwischen dem Flughafen und der Stadt, vorbei am Neubau des Flughafens, dem Stadion, dem City-Centre, vorbei an Straßenhändlern und einem großen Friedhof … erreichen wir das wie eine Oase hinter Mauern abgeschirmte Kloster und Gästehaus der Münsterschwarzacher Missionsbenediktiner.
Bezug der Zimmer, erfrischende Dusche, schmackhaftes Abendessen mit vielen Erinnerungen an dies und das, diesen und jenen – und zum Abschluss ein tansanisches Safari-Bier in kleiner Runde. Auch der neue Abt-Administrator von Peramiho, P. Silvanus, gesellt sich kurz dazu. Frühe Bettruhe.
